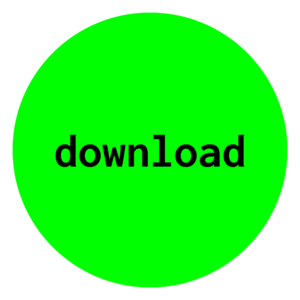1966 — »Wo es Schmutz gibt, gibt es auch ein System«
Mary Douglas’ »Reinheit und Gefährdung. Eine Studie zu Vorstellungen von Verunreinigung und Tabu« wiedergelesen
Von Julia Boog-Kaminski
Mary Douglas’ »Reinheit und Gefährdung. Eine Studie zu Vorstellungen von Verunreinigung und Tabu«
Reinheit und Gefährdung so titelt das schon 1966 publizierte Buch von Mary Douglas, das aktueller nicht sein könnte: Geht es doch um die Regulierung sozialer Verhältnisse durch unterschiedliche Reinheitsgebote, die vor allem Körperflüssigkeiten, Nahrung und Krankheiten betreffen. Mary Douglas nutzt dabei einen sehr weiten Begriff von »Verunreinigung«, der manchmal in die Irre führt und sicher für unsere Zeit noch stärker ausdifferenziert werden müsste; gleichzeitig macht sie damit aber auch deutlich, wie viele Themen mit dem Bereich des ›Unreinen‹ angesprochen sind.
Die Sozialanthropologin gibt anschauliche Beispiele von Stämmen aus der ganzen Welt, die ebenso Angst vor dem »Wahnsinn« ihrer Gemeindemitglieder haben wie vor dem Menstruationsblut ihrer Frauen; die ungeborene Kinder als ebenso große Gefahr ansehen wie einen Mörder unter ihnen; oder die ihre Heiligen als höchst »ansteckend« von sich abzutrennen versuchen. Vor allem aber stellt Douglas heraus, dass dieses Denken und die mit ihm einhergehenden Riten nicht als »magisch« oder »primitiv« abgetan werden können, sondern ebenfalls unser jetziges soziales Leben bestimmen: »Ich bin nämlich der Ansicht, daß die Vorstellungen vom Trennen, Reinigen, Abgrenzen und Bestrafen von Überschreitungen vor allem die Funktion haben, eine ihrem Wesen nach ungeordnete Erfahrung zu systematisieren.« (15) Was wir als Keime bekämpfen, wird in den Stämmen als »Geister« abgewehrt (49). Beide Hygiene- und Reinheitsvorstellungen beruhen also auf einem Glauben und zwar auf dem Glauben an etwas Nicht-Sehbares.
Genau dieses Nicht-Sehbare erzeugt eine Gefährlichkeit, die weit über den einzelnen Menschen hinausgeht: Sie greift das ganze soziale Gefüge an. Als unrein wird angesehen, was eine nicht nur nicht sichtbare, sondern unvorhersehbare Variable in einem scheinbar geordneten System darstellt. Daher auch Douglas‹ markanter Satz: »Wo es Schmutz gibt, gibt es auch ein System.« (52–53) Die Vorstellung von und Angst vor Verschmutzung entsteht keinesfalls aus einer individuellen, psychologischen Konstitution – die gerade bei ›Buschmännern‹ immer wieder als ›anal‹, ›ödipal‹ und ›animistisch‹ bewertet wird (vgl. 79ff.) –, sondern aus der Beschaffenheit von Gesellschaftsstrukturen. Sie sind es, die Hygienemaßnahmen als »symbolische Handlungen« (80) brauchen, um ihre Gemeinschaft rein halten zu können.
»Ein verunreinigender Mensch ist immer im Unrecht« (149), sagt Douglas und macht damit auf die Gefährlichkeit von Individuen ebenso aufmerksam wie auf das Verunreinigende von ganzen Kulturen. Da Gesundheit und Hygiene immer nur in geschlossenen Systemen erhalten werden können, bewacht man angesichts von Seuchen sowohl personelle wie nationale Grenzen um ein Vielfaches strenger. Heutzutage sind es vor allem China, Italien, Spanien und Amerika, die viele Infizierte und ein verworrenes Gesundheitssystem haben und damit als höchst gefährlich eingestuft werden. Wie man aus der Debatte über das ›falsche‹ oder ›schlechte‹ Verhalten dieser Staaten herausfiltern kann, werden sie dabei nicht nur aufgrund von Fahrlässigkeit oder Irrglauben angeklagt, sondern vor allem wegen bewusster Täuschung sowie zu großer (Spanien, Italien) oder fehlender (Amerika, China) Nächstenliebe. So hat Reinheit nicht nur eine soziale, sondern auch moralische Seite.
Als unrein gilt alles das, was »hybrid« ist: Sowohl klebrige Konsistenzen, die weder flüssig noch fest sind, als auch Tiere, die nicht eindeutig in der Luft, im Wasser oder an Land unterwegs sind, oder Menschen, die sich in uneindeutigen Stadien befinden: Die ungeborenen Kinder, die Schwangeren, die Menstruierenden und vor allem – die Kranken. Mit ihnen wird die Gemeinschaft sowohl mit ihrer Vergänglichkeit konfrontiert als auch mit scheinbar übernatürlichen Kräften dieser kontaminierten Personen, die sich keinesfalls auf den Hexenglauben ›primitiver‹ Gemeinschaften reduzieren lassen. Was in vielen Stammeskulturen insbesondere Frauen und Kinder zu »witches« macht, lässt heutzutage einen Kranken zum ›Superspreader‹ werden. Dieser hochinfektiöse Mensch wird oft noch durch »Super-Coughs« oder einfach nur »Super-Breath« digital untermalt, was die Übermacht des Kranken und damit die Angst vor ihm drastisch nährt.
Hier wird ein weiterer Punkt wichtig, den Douglas herausarbeitet: Hybridität meint nämlich sowohl bereits beschriebene »Zustände des Übergangs« (126) als auch alle Lebewesen, die »kriechen, krabbeln oder wimmeln« (77). Zu eben diesen Lebewesen gehört auch der Coronavirus: Es wird immer wieder als schwärmendes, auf den Stock-Images mit vielen Saugnäpfen oder Beinchen ausgestattetes Kleinstier gezeigt, das sich besonders in Pandemiezeiten scheinbar magisch durch die Haut bohren und in die Atemwege gelangen kann, gleichsam ohne den Umweg der Tröpfcheninfektion zu nehmen. Wie die ›Superspreader‹ hat also das Virus selbst eine Supermacht, die es durch sein undefinierbares Wesen, sein nicht greifbares Wirken im menschlichen Körper sowie zwischen den Menschen erlangt.
Mit der Lektüre von Douglas Buch erscheint die heutige, westliche Medizin damit genauso von »Magie und Wunder« (so ein Unterkapitel) beherrscht, wie die Rituale eines Schamanen. Zwar kann die Moderne mit ihren Mikroskopen und Technologien tiefer in die uneinsehbaren, angstmachenden Bereiche vordringen, doch – wie man aktuell bei der verzweifelten Suche nach Immunstoffen feststellen kann – leidet sie ebenfalls unter blinden Flecken und reinen Mutmaßungen. Genau an dieser Stelle verbreitet sich Panik: »Sowohl wir als auch die Buschmänner begründen das Vermeiden von Verunreinigungen mit einer drohenden Gefahr.« (92) Während zum Beispiel die afrikanischen Dinka, die sich der Douglas stark beeinflussende Durkheim näher ansah, Tänze veranstalten, um ihre ›dreckige‹ verdorrte Erde mit Regen zu waschen oder befürchten, dass ihre Männer allein von der Nähe einer Frau geschwächt werden; haben wir derzeit Angst, dass nur die räumliche Anwesenheit eines Coronakranken uns infizieren könne und glauben, dass Vorerkrankte mit besonderer Vorsicht zu behandeln sind. Aus zwei Gründen: Offiziell, weil man sie schützen will, hintergründig aber wohl, weil sie in ihrem eigenen ›Hybridsein‹ eine größere Gefahr bedeuten.
Deutlich wird, dass es die Kombination von »Reinheit und Gefährdung« ist, die Risikogruppen ebenso wie Kranke zu ausgeschlossenen Personen in Seuchenzeiten macht. Sie müssen nicht nur zum eigenen Schutz, sondern zum Schutze der ganzen Gesellschaft ausgeschlossen werden. Da durch sie das gesamte Wirtschaftssystem ›leidet‹ (das in Corona-Zeiten mit ebenso vielen Krankheitsmetaphern versehen wird, wie die Pandemie selbst) und weil sie ansteckender und vom Tod behafteter wirken als die ›normalen‹ Menschen. Doch diese Angst kann nur bestehen bleiben, wenn weiterhin geglaubt wird, »daß Tod und Leiden keine unabdingbaren Bestandteile der Natur« seien (231), betont Douglas. Ihre Analysen der Stammesgesellschaften und im wahrsten Sinne des Wortes ›Übertragungen‹ auf das moderne Sozialgefüge zeigen, wie sehr unsere heutige Gesellschaft genau daran krank, was sie bei den ›Primitiven‹ als ›magisch‹ abtut: »Die rituelle Darstellung des Todes ist ein Schutz – nicht gegen den Tod, sondern gegen den Wahnsinn.« (229) Gerade jetzt wären Riten und damit eine Integration von Krankheit und Tod in das alltägliche Sozialleben besonders wünschenswert: »Kulte [motivieren] ihre Initianden, sich umzuwenden und den Kategorien ins Auge zu blicken, auf denen ihre gesamte umgebende Kultur aufbaut, und sie als das zu erkennen, was sie sind – fiktive, von Menschen geschaffene, willkürliche Kreationen.« (220)
Mary Douglas’ »Reinheit und Gefährdung. Eine Studie zu Vorstellungen von Verunreinigung und Tabu«