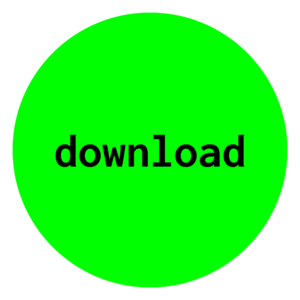1998 – Jede Gesellschaft hat die Wissenschaft, die sie verdient
Isabelle Stengers »Wem dient die Wissenschaft?« wiedergelesen
Von Kerstin Weich
Isabelle Stengers »Wem dient die Wissenschaft?«
Sciences et Pouvoirs lautet der Titel der französischen Originalausgabe, welche die Wissenschaftsphilosophin Isabelle Stengers 1997 in Paris publizierte. In der Übersetzung von Bernd Wilczek fallen die Pluralitäten zugunsten eines deutschen Titels weg, der (beunruhigend wie aufrüttelnd) an Heideggers Rede vom Wissenschaftsdienst für Volk und Führer von 1933 erinnert. Der gesellschaftspolitische Einsatz von Stengersʼ früher Wissenschaftsstudie wurde damit hoch veranschlagt. Eingelöst wird dieser vor allem durch Stengersʼ Freude an der Vermittlung, mit der die Intimitäten, Verwirrspiele und Machtformationen von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft in dem schmalen Bändchen einer weiten Leser*innenschaft zugänglich gemacht werden.
Wenn 1998 noch dazugehört haben mag, ein Nachdenken über die Grenzen zwischen den drei Instanzen überhaupt als relevant und interessant auszuweisen, dann übernimmt diesen Part heute die weltweite Covid-19-Pandemie. Eine Reihe von Fragen, die Stengers mit Hilfe von lebensnahem Anschauungsmaterial entwickelt, liefert die ›Corona-Krise‹ frei Haus: Handelt es sich bei Corona um ein epidemiologisches oder um ein politisches Problem? Wer ist für die Seucheneindämmung zuständig? Entscheiden Regierungen oder Expert*innen? Wie kommunizieren Expert*innen und Regierungen miteinander – und wie vermitteln sie ihre Beschlüsse an die Öffentlichkeit? Wie legitim sind Geltungsansprüche sozialer Bewegungen, welche die eigenen Deutungen des Virus und des Umgangs mit ihm vorbringen? Die Re-Lektüre von Wem dient die Wissenschaft? kann einerseits eine Kritik an einem angenommenen universalen Geltungsanspruch von Wissenschaft, andererseits ein Plädoyer für eine Öffnung sowohl der politischen als auch der wissenschaftlichen Referenzsicherung hin zu gesellschaftlichen Öffentlichkeiten einbringen.
In Wem dient die Wissenschaft kritisiert Isabelle Stengers ein weitverbreitetes Verständnis von Wissenschaft, das nicht nur die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit und der Politik prägt, sondern auch immer wieder in der wissenschaftlichen Praxis selbst zutage tritt. In diesem Verständnis gäbe es nur eine einzige, die monolithische Formation der Wissenschaft. Da es nur einen homogenen Raum der Beweisführung gäbe, wäre die Wissenschaft auch automatisch jene Instanz, die der Gesellschaft das allgemeingültige Bild der Wirklichkeit vorzulegen und ihr damit Einheit zu sichern imstande wäre. Sie wäre der einzige Ort der Gesellschaft, der jenseits der Mächte, Meinungen und Affekte stünde, die die öffentliche Verhandlung charakterisieren. Stengers relativiert diese Darstellung als »Karikatur« und verweist gleichzeitig auf deren praktische Wirkmacht:
»Der Leser und die Leserin werden verstanden haben, daß es sich um eine Karikatur handelt. Die Karikatur eines Bildes von wissenschaftlicher Praxis, das es hinter sich zu lassen gilt. […] Aber es ist nicht ausgeschlossen, daß sich genau solche Gedanken in sehr profunden wissenschaftlichen Arbeiten, in Äußerungen von Experten oder sogar […] in den Ausführungen von Lehrenden wiederfinden.« (Stengers 1998, 12f.)
Die hier erwähnten Gedanken laufen darauf hinaus, einen monopolisierenden Anspruch auf Wirklichkeitsdeutung zu behaupten, der auf dem Experiment als wissenschaftlicher Praxis der Komplexitätsreduktion gründet. Dieser Anspruch schlägt sich nach innen gerichtet in einer repressiven Vereinheitlichung vielfältiger Wirklichkeits- und Problembezüge zu der Wissenschaft nieder. Stengers bezeichnet die Verwechslung von Wissensform und Gegenstand als »Verstümmelung« (ibid., 74) und illustriert ihre Fatalität mit drastischen Bildern von verletzten Labortieren und auf Mitleidslosigkeit trainierten Menschen, die Tierversuche durchführen. Nach außen – an die Gesellschaft gerichtet – zeigt sich das Problem in der Erwartung, dass Wissenschaft die Wirklichkeit offenbart oder vorschreibt. Damit braucht die Gesellschaft nicht länger selbst über die Lösung ihrer Probleme nachzudenken. Dieser monolithischen und monologischen Tendenz stellt Stengers das Projekt einer »Demoralisierung der Macht« (ibid., 81) entgegen: Vervielfältigung der Bezüge, Verkomplizierung der Wirklichkeit, Rettung der Differenzen. Und nicht zuletzt: Demokratisierung jener diskursiven Prozesse, die sich dem Nachweis der Wirklichkeit widmen, nämlich Wissenschaft und Politik.
Wohlgemerkt bedeutet Pluralisierung bei Stengers nicht eine Aufsplitterung der Wissenschaften in lauter Einzelfälle, die sich nicht miteinander vergleichen oder verbinden lassen. Auch wenn die unterschiedlichen Wissenspraktiken es »mit verschiedenen Formen von Wirklichkeit« zu tun haben, »die jeweils vollkommen unterschiedliche Probleme aufwerfen« (ibid., 21), besteht zwischen ihnen weiterhin die Möglichkeit und sogar die Notwendigkeit zur Kommunikation. »Denn schließlich geht es weniger darum, die einzelnen Wissenschaften ›weiterzubringen‹, als vielmehr darum, auf der Höhe eines Problems zu sein, nach dessen Lösung die Gesellschaft verlangt.« (ibid., 98) Ihr Austausch verlangt jedoch aktive Übersetzungsanstrengungen und kreative Aneignungsstrategien. Das schließt die unvermittelte, imperative Verschaltung von Wissensfeldern durch Machtverhältnisse aus. Stengers Sorge gilt also weniger der Herstellung von Konsens als der Maximierung der Problemkomplexität durch Einbezug möglichst vieler Wissensagent*innen.
An diesem Punkt wird der intime Zusammenhang zwischen Wissenschaften und Politik offenbar, der im Zentrum von Stengers Kritik steht. Wenn die Kommunikation zwischen Wissenschaften und der Gesellschaft möglichst offen, plural und inklusiv sein soll, stellt sich die wesentliche Frage, welche Sprecherinstanzen an den deliberativen Prozessen teilnehmen dürfen, mit denen über die Relevanz verschiedener Nachweise und damit über Wirklichkeit entschieden wird. Aus dieser Konstellation entwickelt Stengers zwei wichtige Definitionen:
-
Macht ist vor allem die Macht über den Beweis. Diese Macht besitzen im sozialen Raum letztlich weniger die Wissenschaften als Regierungen und Investor*innen: Sie entscheiden, wo sie den Stellungnahmen der Wissenschaften folgen wollen oder nicht, und ob sie die Vorschläge der Wissenschaften finanziell fördern oder nicht.
-
Die Grenzen einer Demokratie sind die Grenzen der Inklusion jener Interessengruppen, die über die nötigen Mittel verfügen, um Hypothesenbeweise nachvollziehen zu können.
Auf dem Spiel steht der Grad der Rationalität der politischen Legislatur ebenso wie der wissenschaftlichen Wirklichkeitserarbeitung. Beides muss an ihrer demokratischen Qualität gemessen werden. Für die aktuelle Situation bedeutet das, die Hoffnung, von einzelnen Wissenschaftler*innen, Politiker*innen, Mobs oder Social-Media-Kanälen eineabschließende Wirklichkeitsdefinition zu erhalten, als Ausdruck der totalitären Sehnsüchte zu lesen, die bekanntermaßen in Krisen gestärkt werden und offen zu Tage treten. Solche monologischen Wirklichkeitsdefinitionen erfüllen die Bedingungen der von Stengers skizzierten demokratischen Rationalität nicht.
Sie selbst führt als Beispiele die politische Gesetzgebung zu Drogensucht und Schwangerschaftsabbruch sowie die Forschungsperspektive der Medizin auf ihre Patient*innen an. In allen drei Fällen sticht eine strukturelle Exklusion der von der politischen bzw. (wenn man so will) wissenschaftlichen Legislatur Betroffenen ins Auge: Weder Drogensüchtige noch Frauen oder Patient*innen werden als Dialogpartner*innen in die gesellschaftlichen Festlegungen rund um Drogensucht, Schwangerschaft oder Gesundheit/Krankheit einbezogen. Stengers spielt dieses Problem der Grenzen der Inklusion auf zwei Ebenen durch: Zum einen geistert die als Auftakt entworfene Karikatur einer Wissenschaft, die mit einem vereinheitlichenden Universalanspruch versehen wird, durch das ganze Buch. Der Popularität dieses Bildes – und damit auch den Sehnsüchten, die sich mit der Idee einer eleganten Lösung gesellschaftlicher Probleme über wissenschaftliche Beweise verbinden – werden leicht zugängliche Erfahrungen von Pluralität entgegengesetzt. Sogar gegenüber Galileos Kugeln bleibt die Frage berechtigt, was sie zum Verständnis von oder zum Interesse an anderen Formen von Bewegung wie etwa dem Vogelflug beitragen. Die andere Ebene, auf der die Grenzen der Inklusion problematisiert werden, ist die politische: Da wird, etwa mit einem ›passenden‹ wissenschaftlichen Beweis, über andere entschieden, die nicht oder nur bedingt mitreden dürfen. Daran ändert, wer Widerstand organisiert und sich Gehör verschafft – zumindest bis die »Utopie« eines geteilten demokratisch-vernünftigen Umgangs mit den Wissenschaften eingetreten sein wird.
Aktualität verschafft diesen Überlegungen auch, dass sie überwiegend im Kontext von biomedizinischen Fakten und der Gesundheitspolitik angesiedelt sind. Patient*innengruppen, die sich in diesem Bereich Gehör verschafft haben, erscheinen Stengers als erfolgreiche Beispiele konkreter Pluralisierung relevanter Perspektiven und Stimmen. Dass es sich hierbei allenfalls um Etappenziele handelt, da Erfahrungen und Urteile von Patient*innen in den medizinischen Institutionen nach wie vor systematisch als unwissenschaftlich oder subjektiv abgewertet werden, ist nicht nur frustrierend. Es zeigt auch die Notwendigkeit, das Modell ›Betroffene-Minderheiten-kämpfen-um-Anerkennung‹ über es selbst hinauszudenken.
Neben den Patient*innen sind es die vielen Tiere, die in Stengers Überlegungen als Agent*innen dieses Auftrags gelesen werden können. Da sind die Rinder, die im Kontext von BSE zu Seuchenvektoren werden und in der Folge gleich bestandsweise vernichtet. Da sind – oder besser: waren – die Kabeljaue, bevor sie allesamt ›aufgebraucht‹ wurden, sowie die Ratten und Tauben, die in Laboren Praktiken wissenschaftlicher Objektivierung ausgesetzt sind und durch sie verstümmelt werden. Die tierlichen Player in Stengersʼ Plädoyer für Transparenz und umfassende soziale Inklusion in der kommunikativ-demokratischen Verhandlungen rebellieren gegen ihre Exklusion als Objekte und Opfer einer rein menschlichen Gesellschaft. Im Zeichen der für die Corona-Krise sinnbildlich gewordenen Pangolin und der Fledermaus stellt sich das Problem einer politischen Vernunft und einer demokratischen Wissenschaft heute wiederum als eine zoonotische Frage – nur viel lauter und unausweichlicher.
Heute Stengers zu lesen, bedeutet den Widerstand gegen die totalitären Reflexe einer Gesellschaft, die durch Covid 19 selbst zum Kollektivpatienten wurde, zu stärken. Wer dabei die Tiere vergisst, geht sowohl in der Sache als auch politisch fehl. In der Sache, weil die aktuelle Pandemie nicht nur marginal oder partial, sondern ganz grundsätzlich etwas mit Tieren zu tun hat. Auslöser der Pandemie war die Aneignung und Vermarktung tierlicher Lebensräume, ihre Bedingung ist eine Politik des Zusammenlebens, der Ko-Habitation unseres planetarischen Lebensraums. Die Ketten der Infektion, die den Kollektivpatienten zusammenhalten, an der Tier-Mensch-Grenze abschneiden zu wollen, ist so wenig sachlich gerechtfertigt wie weit verbreitet. Mit Stengersʼ Plädoyer kann man in diesem Anthropozentrismus eine Verstümmelung der wissenschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Wahrnehmungsmuster erkennen – und anfangen, solidarische Allianzen für eine speziesübergreifende Gesellschaftsbildung zu etablieren, um ihrer erschreckenden Vehemenz und Macht etwas entgegenzusetzen.
Stengers, Isabelle (1998): Wem dient die Wissenschaft? München: Gerling Akademie Verlag.